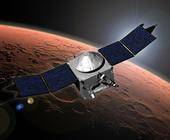Interview
30.03.2009, 14:40 Uhr
Die Auswirkungen des Web 2.0 auf die Firmenkultur
Clay Shirky gilt als einer der führenden Theoretiker des Web 2.0. Im Gespräch mit Wolfgang Sommergut, Redaktor bei unserer deutschen Schwesterpublikation "Computerwoche", erläutert er dessen Auswirkungen auf Unternehmen.
CW: Mit Crowdsourcing möchten Firmen Arbeit an freiwillige Helfer auslagern. Müssen sie dabei kulturelle Barrieren überwinden, um von der offenen Kooperation im Web zu profitieren?
Clay Shirky: Es ist heute nicht mehr schwer, talentierte Leute ausserhalb der Firewall zu finden, die bei der Lösung von Problemen helfen könnten. Und angesichts der verfügbaren Collaboration-Tools sind auch die Hürden und Kosten für eine Zusammenarbeit gering. Die eigentliche Schwierigkeit besteht tatsächlich darin, Personen von ausserhalb zu motivieren, an Projekten des Unternehmens mitzuarbeiten. Firmen müssen sich daher überlegen, wie sie ihre Kultur verändern können, um solche Leute zu erreichen.
CW: Aber offenbar können sich Unternehmen die Früchte freier Arbeit aneignen, ohne sich zu verändern. Ein Beispiel dafür ist Open-Source-Software, die in vielen Rechenzentren läuft.
Shirky: Ja, genau dieses Thema bestimmt derzeit die Debatte um die GNU Public License (GPL). In der Version 2 erlaubt sie noch genau dieses Nutzungsmuster. Unternehmen setzen etwa Linux auf ihren Geräten ein oder betreiben damit Services, die sie über das Web zugänglich machen, ohne etwas an die Community zurückzugeben.
Richard Stallman von der Free Software Foundation möchte diesen Zustand mit der GPL v3 beenden. Wenn etwa Google einen Service auf Basis freier Software anbietet und dafür intern den Code anpasst oder erweitert, dann muss das Unternehmen die Änderungen an das Projekt zurückgeben. Die Open-Source-Szene ist sich jedoch nicht einig, ob sie diesen Weg beschreiten soll, Linus Torvalds etwa ist ein entschiedener Gegner der GPL v3.
Langfristig gehe ich davon aus, dass die Kultur wichtiger ist als die Lizenzbedingungen. Unternehmen, die Community-Produkte nur konsumieren und das damit verbundene Modell von Collaboration und Partizipation nicht annehmen, werden darunter leiden, weil sie weniger innovativ sind.
CW: Sie stimmen also mit Don Tapscott überein, der in seinem Buch "Wikinomics" Firmen dazu anhält, sich zu öffnen und weniger Geheimniskrämerei zu betreiben?
Shirky: Die Hauptthese von Wikinomics lautet: Der Reiz von Crowdsourcing besteht in kostenloser Arbeit, der Preis dafür ist die Veränderung der Firmenkultur. Tapscott wurde allerdings häufig so missverstanden, dass er die Offenlegung aller Firmengeheimnisse und den Verzicht auf Patente fordere.
Vielmehr sollte bei jeder Entscheidung überlegt werden, ob nicht mehr Offenheit möglich ist als in der Vergangenheit. IBM beispielsweise hält weiterhin viele Dinge unter Verschluss, auch wenn sie auf der anderen Seite in zahlreiche Open-Source-Projekte involviert ist. Sie hat herausgefunden, wo ihr mehr Offenheit nützt.
Web 2.0 basiert nicht auf Ausbeutung
CW: Angesichts der vielen kommerziellen Nutzniesser, die von freiwilliger Arbeit im Web profitieren, stellt sich doch die Frage nach einer angemessenen Vergütung? Viele Web-2.0-Sites repräsentieren Millionenwerte, die von den Nutzern geschaffen wurden, aber den Firmeninhabern alleine gehören.
Shirky: Sie gehen doch bestimmt hin und wieder in eine Bar, obwohl die Getränke dort viel mehr kosten als im Supermarkt? Sie tun dies vermutlich, weil sie dort Leute treffen wollen. Niemand käme auf die Idee, einen Anteil am Geschäftserfolg der Bar zu fordern, nur weil er mit seiner Anwesenheit dazu beigetragen hat. Web-2.0-Sites wie beispielsweise soziale Netzwerke tun im Prinzip das Gleiche wie eine Bar, sie stellen die virtuellen Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen die Leute ihre Zeit miteinander verbringen können. Finanzielle Anreize würden ihr Interesse wahrscheinlich verringern, nachdem sie bisher aus Spass mitgemacht haben.
Die Benutzer solcher Sites fühlen sich daher nicht finanziell ausgebeutet. Aber wenn die Eigentümer Freiheiten der Mitglieder beschränken oder den Dienst mit unangemessenen Mitteln vermarkten wollen, dann rebellieren die User. Wir haben das bei Facebook oder Digg erlebt.
CW: Open-Source-Projekte oder Wikipedia kommen auch nicht ohne Hierarchie aus. Worin unterscheiden sie sich denn von der typischen Firmenorganisation?
Shirky: Der vom Web am besten unterstützte Führungsstil ist der des wohlwollenden Diktators und nicht Demokratie. Dieser unterscheidet sich vom Management in Unternehmen in zweierlei Hinsicht. Erstens bestimmen das Geld und die Meinung des Chefs nicht die Richtung des Projekts. Das gilt selbst dann, wenn die Teilnehmer bezahlte Mitarbeiter eines Unternehmens sind, etwa Linux-Entwickler von IBM oder Novell. Das ist radikal neu im Kapitalismus, dass der Geldfluss und die intellektuelle Kontrolle entkoppelt werden.
Der zweite Grund liegt in den Lizenzbedingungen. Jeder, der dazu in der Lage ist, kann den Code nehmen und in seinem eigenen Projekt fortführen. Eine jederzeit mögliche Abspaltung setzt die Manager unter Druck. Sie wissen, dass sie keine andere Legitimation haben als die Akzeptanz der Projektbeteiligten. Sie können ihren Job nur aufgrund ihrer Kompetenz behalten.
CW: Ist gerade Letzteres ein Grund, warum sich die Kooperationsmodelle aus dem Web schwer auf Unternehmen übertragen lassen, wie dies unter dem Begriff "Enterprise 2.0" propagiert wird?
Shirky: In Open-Source-Projekten wird man keinen Projektleiter finden, der nicht selbst Programmierer ist. Das ist anders als in der kommerziellen Softwareentwicklung, wo der CEO aus der Finanzindustrie oder aus dem Marketing kommen kann. Wenn ein Open-Source-Manager eine bestimmte Entscheidung trifft, dann ist sie also nicht nur durch formale Autorität legitimiert.
Unternehmen fällt es hingegen in der Regel sehr schwer, etwa Softwareentwickler in das Top-Management zu befördern. Besonders börsennotierte Firmen können das Management-Modell von Open Source nicht kopieren, aber wie IBM einen hybriden Ansatz wählen und das offene Konzept punktuell adaptieren. Das erhöht den Druck auf alle Projektmanager, weil jene, die selbst Programmierer sind, ein ganz anderes Verhältnis zu ihresgleichen aufbauen.
Ein Kulturwandel ist nötig
CW: Ist somit die Aussicht auf höhere Produktivität der einzige Anreiz für Unternehmen, Kollaborationsmodelle aus dem Web aufzunehmen?
Shirky: Der Wert, der von kooperierenden Individuen im Web geschaffen wird, wächst von Tag zu Tag. Damit Firmen davon profitieren können, brauchen sie eine bestimmte Kultur. In den nächsten fünf Jahren wird sich bei den Technologiefirmen die Spreu vom Weizen trennen und es wird sich zeigen, wer am besten aus diesem enormen Pool schöpfen kann.
CW: Leute arbeiten vor allem aus Idealismus an Open-Source-Projekten oder an der Wikipedia. Sie selbst nannten Liebe als Triebkraft für das Web 2.0. Angestellte lieben in der Regel ihren Boss nicht, manchmal auch nicht ihre Kollegen. Warum sollten sie in einem solchen Kulturwandel beispielsweise ihr exklusives Wissen allen zugänglich machen?
Shirky: Leute versuchen dann Informationen zu horten, wenn sie dafür belohnt werden. Gerade in technischen oder kreativen Berufen haben sich die meisten für ihren Job entschieden, weil sie ihre Arbeit gerne machen. Man kann natürlich ein Arbeitsklima schaffen, bei dem sie ihre Freude am Job verlieren. Aber es ist zweifellos ein Wettbewerbsvorteil, wenn sich die Mitarbeiter engagieren, weil sie sich in einer Umgebung wohl fühlen. Gerade talentierte Leute legen grossen Wert darauf, dass ihre Fähigkeiten gefördert werden und dass sie sich laufend verbessern können. Der einfachste Weg, besser und smarter zu werden, besteht im permanenten Austausch mit Kollegen.
Diese Ansicht beruht auf dem Trugschluss, dass nur eine begrenzte Menge an Arbeit existiere und dass eines Tages die letzte Zeile Code geschrieben würde. Unternehmen bezahlen Programmierer nun für andere Leistungen, beispielsweise die Anpassung von freier Software. Es geht nicht mehr darum, ein und dasselbe Problem tausend Mal in isolierten Projekten zu lösen. Vielmehr kann sie sich die Softwareentwicklung auf höherwertige Leistungen konzentrieren, wenn die Grundlagen ein für alle mal geschaffen wurden. Beispielsweise kann man mit der Implementierung von TCP/IP heute kein Geschäft mehr machen, aber erst die allgemeine und freie Verfügbarkeit des Protokolls hat die ungeahnten neuen Möglichkeiten des Internet geschaffen.