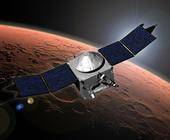Firmenfachbeitrag
22.09.2025, 08:25 Uhr
Bewusster Entscheid statt blindes Vertrauen
Viele Firmen nutzen internationale Cloud-Anbieter. Wer Kontrolle über Unternehmensdaten behalten will, muss prüfen: Wo liegen die Daten? Wer betreibt die Infrastruktur? Welche Abhängigkeiten entstehen – technologisch, rechtlich, strategisch?

(Quelle: Shutterstoc/Digitala World)
In der Schweizer IT-Landschaft wächst das Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Souveränität. Dabei geht es nicht um ein Entweder-oder zwischen lokalen Anbietern und globalen Hyperscalern – sondern um differenzierte Entscheidungen: Welche Daten kann ich ohne Bedenken extern verarbeiten lassen? Wo braucht es zusätzliche Kontrolle, Transparenz oder eine alternative Lösung?
Ein Rechenzentrum in der Schweiz allein reicht nicht aus. Wahre Souveränität umfasst auch die Kontrolle über Betrieb, Technologie, Supportwege und Vertragsbedingungen. Wer diese Fragen ausblendet, gibt unter Umständen mehr aus der Hand, als beabsichtigt – mit Auswirkungen, die weit über IT hinausgehen.
Souveränität ist nicht gleichzusetzen mit dem Datenstandort
Die Sovereign Cloud ist die Antwort auf das Bedürfnis nach vollständiger Datenhoheit. Doch es geht nicht nur um physische Speicherorte. Souveränität bedeutet: Unternehmen behalten die Kontrolle über die gesamte Infrastruktur und Applikationslandschaft – von den Zugriffsrechten bis zur Betriebs-Governance. Hyperscaler können das kaum garantieren, das ist nicht ihr Business- und Prozessmodell. Sie folgen globalen Standardprozessen, die selten mit nationalem Recht oder branchenspezifischen Vorgaben harmonieren.
5 Dimensionen, ein Ziel: Kontrolle
Souveränität hat viele Facetten – und genau hier unterscheiden sich souveräne von standardisierten Cloud-Lösungen. Die fünf Dimensionen im Überblick:
- Standort & Infrastruktur: Wo werden die Daten gespeichert und verarbeitet – physisch und rechtlich? Der Rechenzentrumsstandort ist mehr als eine logistische Frage: Er bestimmt, welche Gesetze gelten, etwa im Hinblick auf Zugriffsrechte staatlicher Stellen. Der US CLOUD Act zeigt: Wer auf US-Infrastruktur setzt, schafft – oft unbeabsichtigt – einen rechtlichen Zugangspunkt für Dritte. Ein klar definierter Schweizer Standort mit lokaler Gesellschaft und Regulation schafft hier Transparenz und Sicherheit.
- Eigentümerschaft: Wem gehören die Cloud-Plattform, die Infrastruktur, die Schlüsselkomponenten? In vielen internationalen Modellen bleibt die Kontrolle über kritische Teile in ausländischer Hand. Erst durch Schweizer Eigentümerschaft an Infrastruktur und Betriebsumgebung kann sichergestellt werden, dass keine externen Interessen Zugriff oder Einfluss erhalten – weder technisch noch wirtschaftlich.
- Technologie & Kontrolle: Welche Technologien und Frameworks werden eingesetzt? Und wer kontrolliert diese? Proprietäre Systeme können zu Abhängigkeiten und eingeschränkter Flexibilität führen. Durch den Einsatz offener Technologien (z. B. Open Source) behalten Unternehmen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung, Individualisierung und Integration – ein zentraler Baustein technologischer Souveränität.
- Governance & Verträge: Wer definiert die Regeln – und auf welcher vertraglichen Grundlage? Hyperscaler bieten oft standardisierte Modelle, bei denen zentrale Vertragsbestandteile nicht verhandelbar sind und Bedingungen des Rechtsraums des Anbieters und dessen Regulators durchgesetzt werden. In einem souveränen Cloud-Modell hingegen lassen sich Governance-Strukturen individuell abbilden – etwa für Rechtemanagement, Sicherheitsvorgaben, Datenrückgabe oder Exit-Strategien. Das schafft rechtliche Klarheit und Planungssicherheit.
- Swiss Team & Operation: Wer betreibt die Systeme – und von wo aus? Für viele Unternehmen ist nicht nur der Standort entscheidend, sondern auch das Team im Hintergrund. Ein Schweizer Operations-Team mit lokalem Support stellt sicher, dass Wartung, Notfallprozesse und Kundenanliegen in der gleichen Zeitzone und im gleichen Rechtsrahmen bearbeitet werden. Das stärkt Vertrauen und Reaktionsfähigkeit – gerade in kritischen Situationen.
Open Source als strategischer Hebel
Ein Element zur Technologiesouveränität liegt im Open-Source-Prinzip. Es erlaubt es Unternehmen, den kompletten Software-Stack zu prüfen, anzupassen und unabhängig von Lizenzzwängen zu betreiben. So lassen sich nicht nur Sicherheitslücken identifizieren, sondern auch Abhängigkeiten von proprietären Anbietern vermeiden. Dass Open Source kein Selbstzweck ist, zeigt sich auch im Betrieb. Eine Architektur soll durchgehend auf offene Technologien setzen, vom Orchestrator bis zur Storage. Der Vorteil: volle Transparenz, Flexibilität und ein klarer Bruch mit Vendor-Lock-ins.
Compliance ist kein Zusatzfeature
Ein häufig unterschätzter Punkt: Rechtliche Vorgaben und branchenspezifische Compliance sind nicht einfach durch internationale Zertifizierungen abgedeckt. Eine souveräne Cloud integriert diese Anforderungen direkt in ihre Servicearchitektur – von der Entwicklung bis zum Betrieb. Idealerweise setzt man dabei auf lokale Rechenzentren, eigene Betriebsteams und eine Architektur, die auch auf regionale Unterschiede reagieren kann. Compliance wird so zum integralen Bestandteil der Vertrauensbasis zwischen Anbieter und Kunde.
Der Preis ist kein Argument – eher die Ausrede
Das gängige Argument gegen souveräne Cloud-Lösungen? Kosten. Hier gilt es festzuhalten: Sovereign Clouds sind nicht teurer als Public Clouds – vergleichbare Services kosten gleich viel. Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen: Wer zusätzliche Security-Services einkauft, zahlt natürlich mehr – aber das liegt nicht am Modell, sondern am Leistungsumfang. Und letztlich: Wie viel ist Unabhängigkeit wert?
Was SLAs wirklich abdecken müssen
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal: Verträge. In Sovereign-Cloud-Umgebungen müssen Service-Level-Agreements mehr leisten. Sie regeln nicht nur Verfügbarkeit oder Supportzeiten, sondern auch Zugriffskontrolle, Datenhoheit, Reaktionsprozesse bei Datenschutzverletzungen und den Umgang mit Eigentümerwechseln. Die Souveränitätsrechte müssen vertraglich verankert sein – transparent, überprüfbar und einklagbar.
KI verändert alles – auch die Anforderungen
Mit dem Vormarsch von Künstlicher Intelligenz wird das Thema Souveränität nochmals dringlicher. KI-Anwendungen basieren auf grossen Datenmengen – oft hochsensibel. Wenn diese Daten in globalen KI-Services verarbeitet werden, droht ein Kontrollverlust. Sovereign Clouds müssen deshalb in der Lage sein, auch KI-Infrastrukturen sicher und lokal zu betreiben. Das gelingt nur mit den richtigen Partnern – technisch, organisatorisch und rechtlich.
Verantwortung lässt sich nicht auslagern
Souveränität kann durchaus unbequem sein. Sie erfordert bewusste Entscheidungen, technologische Verantwortung und strategische Klarheit. Aber sie ist notwendig. Denn wer seine digitale Infrastruktur in die Hände globaler Anbieter legt, überlässt ihnen nicht nur Daten, sondern auch Kontrolle, Transparenz und letztlich Vertrauen. Schweizer Unternehmen haben die Wahl: souverän handeln – oder weiter hoffen, dass nichts passiert.
Zum Autor und Firma
Kurt Ris ist CEO und Mitgründer der EveryWare AG
Zum Unternehmen: EveryWare ist ein führender Schweizer Cloud- und IT-Service-Provider mit Schwerpunkt auf Hybrid-, Private- und Public-Cloud-Lösungen. EveryWare unterstützt Businesskunden mit technologieunabhängigen Plattformen und professionellen Services – realisiert von über 100 Mitarbeitenden, davon 90 % Engineers. Mit fast 30-jähriger Expertise und über 300 business-kritischen Cloudplattformen für Kunden übernehmen wir Verantwortung für Verlässlichkeit, Transparenz und höchste Servicequalität.
Mehr Informationen: www.everyware.ch
Dieser Beitrag wurde von der EveryWare AG zur Verfügung gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar. Computerworld übernimmt für dessen Inhalt keine Verantwortung.