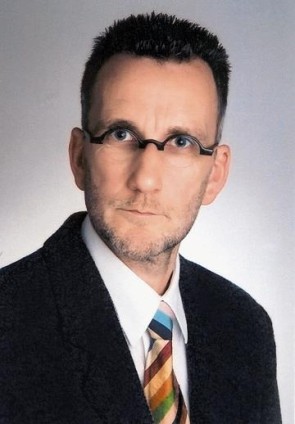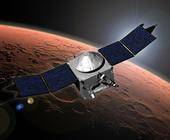28.04.2008, 08:31 Uhr
Beim Informatikermangel herrscht Fantasielosigkeit
Firmen und Ausbildungsinstitute in der Schweiz unternehmen durchaus etwas gegen den Informatikermangel. Dabei agieren sie allerdings ziemlich ideenlos.
«Wir unterstützen den IT-Nachwuchs aktiv, etwa mit Engagements bei Ausbildungsinstituten.» Barbara Belser, Head HR Business Partner IT Schweiz bei Credit Suisse
Unternehmen in der Schweiz klagen über den ausgetrockneten Informatikermarkt und Probleme bei der Mitarbeitersuche. Vor allem Spezialisten sind schwer zu finden. Dennoch gehen die Bemühungen, um die Attraktivität des Informatikstandorts Schweiz oder der Arbeit als Informatiker zu steigern, kaum über Altbekanntes hinaus. Eine exklusive Computerworld-Umfrage bei 26 Schweizer Unternehmen und Ausbildungsinstituten zeichnet ein düsteres Bild.
Firmen sind unterschiedlich betroffen
Die Credit Suisse (CS) hat momentan in der Schweiz nicht weniger als 200 offene IT-Stellen. Speziell in den Bereichen Pro-jekt-Management, Business Engineering und Quality&Test-Management sucht die Schweizer Grossbank hochqualifizierte Berufsleute, so Barbara Belser, Head HR Business Partner IT Schweiz.
Damit steht die CS keinesfalls alleine da. Die meisten der von uns befragten Unternehmen wie die Schweizerische Post, Swisscom, Cablecom, Hewlett-Packard (HP) und Sunrise spüren den ausgetrockneten Markt und haben Mühe, ihre IT-Stellen neu zu besetzen. Microsoft trifft dies sogar doppelt, kämpfen die Redmonder doch nicht nur mit den eigenen Problemen bei der Mitarbeitersuche, sondern auch mit denjenigen ihrer Partner. «Wir können das volle Potenzial unserer Lösungen nur dann ausschöpfen, wenn sowohl unsere Partner als auch unsere Kunden über qualifizierte Fachkräfte verfügen», so Barbara Josef, Pressesprecherin von Microsoft in der Schweiz.
Auch bei AXA Winterthur kennt man die Probleme. Die Versicherungsgesellschaft versucht den erhöhten Bedarf an IT-Spezia-listen durch Effizienzsteigerungen in ihren Prozessen und mit alternativen Beschaffungsmethoden zu decken. Nicht nur die Unternehmen sehen sich mit dem Informatikermangel konfrontiert. Die Situation der Ausbildungsinstitute sieht kaum rosiger aus. Auch sie kämpfen mit rückläufigen Studentenzahlen.
Ausbildungsinstitute kämpfen auch
Bei den Massnahmen gegen den Informatikermangel steht Imagearbeit weit oben auf der Prioritätenliste. Mit Tagen der offenen Türe, Maturandenanlässen, speziellen Frauenförderungstagen oder Roadshows wollen die Institute mehr Jugendliche für eine Ausbildung im IT-Bereich gewinnen.
Beim Informatikermangel herrscht Fantasielosigkeit
Mit Veranstaltungen wie «Open Class» und Roadshows an den Mittelschulen feilt laut Jürg Gutknecht, Vorsteher des Informatikdepartements, etwa die ETH Zürich am Image der Informatik. Auch Anlässe, die das breite Spektrum der Informatik aufzeigen, wie beispielsweise die «Digital Arts Week» oder Jubiläumsveranstaltungen wie 150 Jahre ETH seien dafür geeignet.
Auf ähnliche Weise will die Hochschule für Technik in Rapperswil (HSR) das Image der IT aufpolieren. Im Rahmen einer Ausstellung am Tag der Informatik am 29. August 2008 zeigt die HSR «Informatik zum Anfassen». Die Vortragsreihe «Informatik: spannend und unterhaltsam - ein Blick hinter die Kulissen» soll der Öffentlichkeit ein aktuelles und korrektes Bild von Informatik vermitteln. Laut Lothar Müller, Abteilungsvorstand Informatik an der HSR, wolle man zeigen, dass Informatik etwas anderes ist als die Benutzung von Word und Excel. Auch die Uni Zürich will gemäss Abraham Bernstein vom Informatikdepartment mit der Reihe «Wie funktioniert eigentlich...?» im Rahmen der 175-Jahr-Feier die Informatik der breiten Öffentlichkeit näher bringen.
Ob die Imagekorrektur mit diesen Massnahmen gelingt bleibt abzuwarten. Bisherige Bemühungen brachten angesichts der rückläufigen Studentenzahlen wenig Erfolg.
Firmen sind fantasielos
Kaum phantasievoller zeigen sich die Unternehmen bei ihren Massnahmenpaketen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland wird häufig als die Lösung gegen den Informatikermangel propagiert. Mit dem Engagement in Verbänden und Organisationen wollen die Firmen die Anerkennung der IT-Branche in Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik vorantreiben. Auch auf Auftritte an Fachkonferenzen, Podiumsdiskussionen und sonstigen IT-Veranstaltungen schwören die Unternehmen.
So pflegt zum Beispiel Microsoft den Kontakt mit den Hochschulen durch die Student Partners, die parallel zu ihrem Studium Teilzeit für die Software-Gigantin arbeiten, oder durch Projekte wie «Microsoft Innovation Cluster for Embedded Software» (ICES), wo IT-Nachwuchstalenten in Zusammenarbeit mit der ETHZ und EPFL attraktive Forschungsmöglichkeiten geboten werden. Auch die Credit Suisse fördert laut Belser den IT-Nachwuchs mit einer Vielzahl von Initiativen, wie beispielsweise Engagements bei Ausbildungsinstituten wie der ETH Zürich und den Universitäten in St.Gallen, Zürich, Bern und Basel sowie der Hochschule für Technik und Architektur in Luzern oder der Fachhochschule Ostschweiz. Ebenso wie Swisscom unterstützt die Schweizer Grossbank zudem Praktika und Diplomarbeiten sowie Dissertationen (2008 rund 40).
Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter ausserhalb des Hochschulumfeldes scheinen die meisten Unternehmen ähnlich ideenlos. Sie verlassen sich auf traditionelle Kanäle wie Zeitungsinserate, Online-Jobportale und Head Hunter. Neu versuchen einige der Unternehmen, darunter AXA Winterthur, Dell und Microsoft, ihr Glück vermehrt auch im nahen Ausland.
Beim Informatikermangel herrscht Fantasielosigkeit
Immerhin ist Microsoft überzeugt, dass das persönliche Netzwerk der Mitarbeiter eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Auch Social Communities oder Netzwerke gewinnen laut der Software-Gigantin bei der Rekrutierung an Bedeutung, da sich auf diese Weise gezielt spezifische Profile finden lassen.
In der Summe beschränken sich die Unternehmen grösstenteils darauf, die Absolventen von Universitäten und Hochschulen abzugreifen. Diese Massnahmen fruchten angesichts der rückläufigen Zahl von IT-Lehrlingen und Informatikstudenten nicht genügend. Bei Hewlett-Packard Schweiz ist man dennoch überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit den Hochschulen wichtig ist, auch wenn sie allein nicht genügt, um den gegenwärtigen Mangel an IT-Fachkräften zu beheben.
Vernachlässigte Bereiche
Roadshows, Absolventenkongresse und Auftritt an Hochschulanlässen scheinen nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Den Unternehmen und Ausbildungsinstituten fehlen die zündenden Ideen, wie mehr Jugendliche für ein Informatikstudium begeistert werden können. Fast vergessen gehen bei dieser Debatte zudem die Lehrlinge. Ein Bereich, in dem die Wirtschaft sehr direkt aktiv werden könnte.
Ähnlich sieht dies Lothar Müller, Abteilungsvorstand Informatik an der Hochschule für Technik in Rapperswil (HSR). Es müsse bei den Berufslehren angesetzt werden, um mehr Interessenten für die Informatik zu finden. Alfred Breu von der Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik (ZLI) doppelt nach: Es gebe heute vier Mal mehr IT-Fachkräfte, die aus dem Berufsleben ausscheiden, als das Bildungssystem jährlich an Abgängern hervorbringe (10000 gegenüber 2500).
Entsprechend versucht die ZLI, die Betriebe zur Ausbildung zu bewegen oder mehr Lehrstellen zu schaffen. Dabei unterstützt sie die Unternehmen und holt im -Bedarfsfall selbst die nötige Ausbildungsbewilligung für sie ein. Andererseits gehe man in Schulen, an die Berufsmesse, lade zu rund einem Dutzend Informationsnach-mittagen ins Basislehrjahr ein, halte Vorträge bei Anlässen der Berufsberatungsstellen und informiere die Jugendlichen über die Informatik, so Breu. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der ZLI bilde auch die Aktualisierung der Ausbildungsinhalte, die -Erstellung von Hilfsmitteln wie Ausbildungsleitfaden und Einsatzbeispiele sowie die Aus- und Weiterbildung der Ausbildner selbst. Dabei sei vor allem wichtig, das Bild des Informatikers zu klären. «Das sind keine PC-Hacker, sondern Fachleute, die ständig im Kundendienst stehen und an vielen Produkten mitentwickeln.»
An einer weiteren, wichtigen Zielgruppe scheinen die Bemühungen ebenfalls vorbeizugehen: an den Gymnasiasten. Um mehr IT-Studenten zu generieren, müsste man die künftigen Studierenden, also Gymnasiasten oder Lernende mit Berufsmatura, für die IT be-geistern. Daher stellt sich die Frage, wieso die Firmen ihren Fokus nicht verstärkt von den Hochschul- und Uniabsolventen auf die Gymnasiasten verlagern. Industrievertretern zufolge zeigen die Mittelschulen aber wenig Interesse an Veranstaltungen zur Informatikförderung. Die Gymnasien argumentierten, sie seien mit der Wissensvermittlung beauftragt und kämpften ohnehin mit bereits übervollen Lehrplänen.
Zudem verkompliziert in der Schweiz der Föderalismus die nötige Harmonisierung des Ausbildungssystems mit den Interessen, respektive Bedürfnissen der Wirtschaft. Traditionell orientiert sich unser Bildungssystem stark an humanistischen Idealen, die Wirtschaft dagegen eher weniger.
Beim Informatikermangel herrscht Fantasielosigkeit
Ein möglicher Weg aus der Krise führt über Quereinsteiger mit langjähriger Informatikerfahrung ohne Abschluss. Hier engagiert sich die ZLI für die Anerkennung der erworbenen Kompetenzen, so Breu. Ebenso wichtig sei die gute Ausbildung von Berufsumsteigern.
Immerhin haben die Unternehmen angesichts der prekären Lage die Bedeutung ihrer Mitarbeiter erkannt. Die interne und externe Weiter- respektive Ausbildung der Quereinsteiger ohne Abschluss wird entsprechend gefördert. Dabei variiert allerdings der Unterstützungsgrad der einzelnen Firmen. Wie Andreas Zeitler, Vice President und Regional Manager für die Region Zent-raleuropa bei Symantec, zu Protokoll gibt, fördert die Sicherheitsspezialistin staatlich anerkannte Diplome und berufsbegleitende Bachelor-, Master- und Postmaster-Studiengänge. Zu Fortbildungsmassnahmen sind alle Mitarbeiter zugelassen, die länger als sechs Monate für die Sicherheitsspezialistin tätig sind.
Die Credit Suisse verfügt sogar über ein eigenes IT-Institut. Die Business School konzipiert und koordiniert zusammen mit internen Fachspezialisten die Gesamtausbildung. Auch unterstützt die Schweizer Grossbank Nachdiplomkurse und strategische IT-Trainings. Insgesamt werden durchschnittlich zehn Arbeitstage pro Jahr und Mitarbeiter für Aus- und Weiterbildungen investiert.
Während Dell, Cablecom und HP ihre Mitarbeiter sowohl finanziell als auch zeitlich unterstützen, beispielsweise mit Bildungsurlaub, übernimmt Generali zwar zu einem nicht genannten Maximalbetrag die Schulungskosten, die Arbeitszeit wird in der Regel aber nicht zur Verfügung gestellt. Swisscom IT Services regelt die Kostenübernahme individuell. Bei angeordneten Ausbildungen gehen sowohl Kosten als auch Zeit vollumfänglich zu Lasten von Swisscom IT Services. Bei nicht angeordneten Ausbildungen trägt das Unternehmen maximal 80 Prozent der Kosten.
Die Ausbildungsinstitute versuchen derweil mit berufsbegleitenden Angeboten eine Lösung für den Informatikermangel zu finden. Der Weg aus der Misere führt bei der ETH Zürich beispielsweise über Nachdiplom-Zertifikatskurse in Informatik. Zusätzlich offeriert die ETH während der -Semesterferien ein- bis dreitägige Kompaktkurse für die Industrie. Die Universität Zürich offeriert derweil laut Abraham Bernstein vom Informatikinstitut jeden Sommer den «IfI Summer» mit einer Reihe von Kursen sowie Zertifikatskurse in IT-Projekt-Management an.
Auch die Hochschule Luzern (HSL) geht einen ähnlichen Weg. Laut Hansjörg Diethelm, Abteilungs- und Studiengangleiter Informatik an der HSL, können die Studierenden des Bachelorstudiengangs Informatik am Montag, Dienstag und Mittwoch einer Berufstätigkeit nachgehen. Auch das Angebot der Hochschule für Technik in Rapperswil (HSR) umfasst zwei berufsbegleitende Ausbildungen, einerseits zum Master of Advanced Studies in Software Engineering, andererseits zum Master of Advanced Studies in Human Computer Interaction Design. Die HSR bietet zudem ab Herbst 2008 ein Teilzeitstudium Informatik an. Ausserdem werden Überlegungen angestellt, Quereinsteigern den Einstieg ins Informatik-Studium zu erleichtern.
Beim Informatikermangel herrscht Fantasielosigkeit
Neue Wege beschreiten
Die meisten Unternehmen scheinen angesichts des Informatikermangels ratlos und haben keine kreativen Vorschläge. Doch es gibt wenige Ausnahmen, die mit innovativen Ansätzen eine Lösung für die Misere suchen.
Eine davon ist die Stiftung WISS. Sie will laut dem Stiftungsrat und Delegierten der Geschäftsleitung René Balzano mit verschiedenen zusätzlichen Bildungsangeboten neue Interessengruppen adressieren und so einen grösseren Personenkreis für die Informatik begeistern. In Kürze wird beispielsweise eine Angebotsreihe für Wiedereinsteigerinnen lanciert. Ein weiteres Projekt richtet sich an Führungskräfte. Manager sollen durch gezielte, in kurzen Seminaren erworbene IT-Kenntnisse dazu beitragen, dass es gar nicht so viele IT-Spezialisten braucht, wie immer postuliert wird. «Hier steht im Zent-rum», so Balzano.
Im Bereich der Grundbildung hat die Stiftung letzten Sommer gemeinsam mit der Jacobs-Stiftung und mit Unterstützung des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie (BBT) das neue Berufsbild «Infopraktiker» lanciert. Diese zweijährige Attestausbildung richtet sich an Sek-B/C-Abgänger und soll einer weiteren Personengruppe den Weg in die Informatik öffnen. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern doppelt nach. Auch der Kanton Bern fördert den Informatikbereich mit einer zweijährigen beruflichen Grundbildung: Gemeinsam mit der Organisation der Arbeitswelt (i-Bern) hat der Kanton Bern 2006 das Projekt Infopraktiker gestartet. Nach dem Abschluss haben die Lernenden die Möglichkeit, in die Ausbildung als Informatiker einzusteigen. Als weitere mögliche Massnahme, um die Informatikbranche in Zukunft zu fördern, sieht die Berner Erziehungsdirektion den direkten Übertritt vom Gymnasium an Fachhochschulen.
Eine anspruchsvolle Variante der Informatiklehre entwickelt WISS derzeit in Zusammenarbeit mit einem ihrer Schwesterunternehmen in Zürich. Im Rahmen einer vier- bis fünfjährigen Ausbildung bietet die Stiftung die Möglichkeit, gleichzeitig die Informatiklehre, die Berufsmatura sowie die Passerelle für das Studium an einer Universität oder an der ETH zu erwerben. Dieses in der Schweiz einzigartige Angebot soll noch dieses Jahr lanciert werden.
Während HP - neben der Zusammenarbeit mit Young Enterprise Switzerland/Junior Achievement - im Rahmen des Engagements für die informatica08 auch das Trainings-Camp für die diesjährige Informatik-Olympiade zu unterstützen gedenkt, will die ETH Zürich dem IT-Fachkräfteschwund mit einem Kompetenz- und Beratungszentrum für Informatikunterricht (KBZ) ent-gegenwirken. Damit soll an der ETH die Informatikausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gefördert werden. Zudem befindet sich eine deutsch-englische Zeitschrift «Fachdidaktik Informatik» derzeit in Planung.
Beim Informatikermangel herrscht Fantasielosigkeit
Nicht alle Firmen haben Probleme
Von der ganzen Problematik wenig tangiert sieht man sich bei Symantec. Laut Zeitler gestaltet sich die Suche nach qualifiziertem Personal zwar schwierig. Dennoch gelinge es der Sicherheitsspezialistin, die qualifizierten Mitarbeiter zu rekrutieren, die sie benötige. Im Gegensatz zu vielen Firmen bezeichnet Dell weniger den Mangel an qualifizierten Mitarbeitern als Problem, sondern vielmehr die Rekrutierung vielsprachiger IT-Mitarbeiter. Auch Helvetia, Bâloise, Generali und die ZKB konnten bislang jede Vakanz in akzeptabler Frist besetzen.
Fazit
Revolutionäre Ideen im Kampf gegen den Informatikermangel sind in der Schweiz dünn gesät. Nur wenige Firmen und Organisationen arbeiten an neuen, fantasievollen Angeboten, um dagegen anzugehen. Laut Walter Brenner von der Direktion des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen müssen Wirtschaft, Politik und Ausbildungsinstitute für ein besseres Image der Schweizer Informatik alle in eine Richtung ziehen.
Die Wirtschaft müsse bereit sein, Geld zu investieren und die Karrie-re-möglichkeiten in der IT-Branche klarer aufzuzeigen. Die Politik müsse derweil klar kommunizieren, worin die Herausforderungen der Schweiz in der Zukunft liegen. Ausserdem müsse klar dargelegt werden, was durch den Informatikermangel für Probleme entstehen. Die Credit Suisse doppelt nach: Auch sie ist der Überzeugung, dass eine Attraktivitätssteigerung der Fächer Naturwissenschaften und IT nur durch ein gemeinsames Handeln von Schulen, Politik und Wirtschaft erreicht werden kann.
Oder um es mit den Worten von Alfred Breu zu sagen: «Es gilt, Vorurteile abzubauen und vor allem das Gerücht zu beseitigen, Informatik fände inskünftig ohnehin nur in Indien statt. So ziemlich das Gegenteil wird eintreten!»
Alina Huber