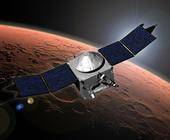27.10.2017, 08:43 Uhr
Smarte Schweizer Städte
Von der Laterne mit Sensoren bis hin zum vernetzten Quartier: Schweizer Städte bauen auf die digitale Zukunft.
Die Zukunft steht in Wädenswil. Sie erhellt die Nacht, teilt Daten über WLAN und misst die Luftbelastung durch Feinstaub. Auch Autos mit Akkus lädt sie auf: die smarte Strassenlaterne. Für Regierungsrat Ernst Stocker etwa, Finanzdirektor des Kantons Zürich, ist sie aber weit mehr. «Sie ist ein Leuchtturm, der weit strahlt», wie Stocker anlässlich der Einweihung im September sagte. Die Smart Tower genannte intelligente Strassenlaterne ist ein Projekt, das die Stadt mit den Partnern Elektron, EKZ und SBB realisierte. Ein weiteres Leuchtturmprojekt ist das Basler Quartier Erlenmatt-West. Jeder neue Bewohner des Quartiers erhält mit dem Wohnungsschlüssel einen Zugangscode zur Erlen-App und damit Zugriff auf Informationen zu seinen Hausgeräten, deren Energieverbrauch sowie Tipps aus der Nachbarschaft. Mit der App können die Bewohner auch mit den Nachbarn und der Verwaltung kommunizieren und teilweise auf Concierge-Dienste zugreifen. Auch im Verkehr gibt es erste Projekte. So kündigte die Post etwa kürzlich an, die Testphase ihres autonom fahrenden Busses in Sion auszuweiten. Einen Schritt weiter ist die Stadt Fribourg. Das regionale Transportunternehmen TPF hat bereits ein autonomes Shuttle auf dem Weg zum Marly Innovation Center in ihren öffentlichen Fahrplan aufgenommen.
Ein Milliardengeschäft
Die Vernetzung von öffentlicher Infrastruktur liegt im Trend. Und dürfte zum Milliarden-Business werden: Bis 2023 könnte das weltweite Marktvolumen bei rund 28 Milliarden US-Dollar liegen, taxiert Roland Berger. Heute liege es bei etwa 13 Milliarden Dollar, schreibt das Beratungsunternehmen in seiner Studie «The Rise of the Smart City». «Die Zahl der Städte, die einen strategischen Ansatz in Richtung Smart City verfolgen, nimmt seit einigen Jahren deutlich zu», erläutert Thilo Zelt, Partner von Roland Berger. «Allerdings tun sich die meisten Städte noch sehr schwer, wenn es darum geht, hinreichend integrierte und umfassende Strategien zu definieren.» Das hat verschiedene Gründe. Einer liegt in der Definition. Der Begriff Smart City ist nicht leicht in einem Satz zu definieren, es ist ein weites Feld. Es reicht von Mobilitätskonzepten, die den Verkehr mit Zügen und Bussen mit autonomen Fahrzeugen verbinden. Ein anderer Bereich ist die Verwaltung und das Bürger-Engagement etwa mithilfe von Anwendungen für die Verwaltung. So wie etwa der E-Umzug der Stadt Zürich. Über 200’000 Personen nutzten im vergangenen Jahr die Lösung, um sich vom alten Wohnort ab- und in der neuen Gemeinde anzumelden. Und dies innerhalb weniger Minuten. Auch das ist Smart City. «Eigentlich ist Smart City ein falscher Begriff, denn eine smarte Stadt betrachtet sich nicht als City, sondern als urbaner Raum, der vernetzt ist mit anderen Räumen», sagt Mike Vogt, Initiator der Fachkonferenz Smart Suisse. «Wir interpretieren die Schweiz als Agglomeration mit derzeit 8,5 Millionen Einwohnern im Herzen Europas, deren Zentren über den öffentlichen Verkehr verbunden sind.» Daher spricht Vogt auch lieber von Smart Suisse.
Gute Voraussetzungen für Smart-City-Projekte
Die Voraussetzungen für Smart-City-Projekte in der Schweiz sind gut. Ein Hauptgrund sieht der Smart-City-Experte im Breitbandausbau. Gemäss einer Statistik der OECD aus dem vergangenen Jahr ist die Schweiz der einzige Staat mit mehr als 50 Breitbandanschlüssen pro 100 Einwohner und steht damit deutlich an der Spitze der OECD-Länder. Der Smart-City-Trend wird auch von anderen Entwicklungen vorangetrieben. Etwa durch das Smartphone und die allgemeine Verfügbarkeit von Breitbandinternet im öffentlichen Raum. «Vor etwa 15 Jahren waren die Leute gewohnt, dezentral einzukaufen. Heute nutzen etwa 85 Prozent der Schweizer auch das Smartphone, um im Internet einzukaufen, sich zu informieren oder um mit Freunden Ferienerlebnisse auszutauschen», führt Vogt aus. Das habe zu einem gesellschaftlichen Wandel geführt. Dieser löse einen Druck auf die Stadtverwaltungen aus. Dieser sei noch nicht sehr hoch. Weswegen die Städte das Thema Smart City auch erst allmählich angehen. Und auch die Bürger hätten die zahlreichen Möglichkeiten bisher kaum realisiert. «Das ist eine Chance für Städte und ihre Verwaltungen, um von ihren Bürgern wahrgenommen zu werden», betont Vogt. Die Stadtverwaltung könnte etwa eine Push-Meldung versenden mit dem Hinweis, dass morgen wieder das Altpapier abgeholt wird.
Städte haben Chancen erkannt
Entwickelt sich durch den Service ein Austausch wie z.B. mit der App «Züri wie Neu», kann auch die Stadtverwaltung durch das Feedback der Bewohner hinzuzulernen und seine Services und im Endeffekt auch die Attraktivität der Stadt verbessern. Eine weitere grosse Chance sieht Vogt im Bereich Open Data. Städte und Gemeinden könnten ihre Daten offenlegen und die Bürger einladen, daraus etwas zu gestalten. Eine Idee, wie sie etwa die Stadt Zürich Anfang des Jahres mit dem Hackathon «Make Zurich» umsetzte. An dem Event entwickelten Freiwillige etwa ein Sensorensystem für die Messung der Luftreinheit, das auf Trams montiert werden könnte. In der Schweiz werden derzeit massgeblich die Bereiche Energie und Mobilität bearbeitet, hält Benjamin Szemkus fest. Denn beide Bereiche stellten eine unmittelbare Herausforderung dar. Szemkus ist Programmleiter bei Smart City Schweiz im Auftrag von Energie Schweiz für Gemeinden. Das Potenzial ist laut Szemkus sehr gross. Durch technische Möglichkeiten liessen sich – derzeit noch in einem bescheidenen Ausmass – Geschäftsmodelle für Städte finden. Ein Beispiel sei das Smart Parking mit flexiblem Pricing. Ein weiterer Ansatz sind Parkleitsysteme, wie sie etwa die Stadt St. Gallen seit dem Sommer testet. «Zahlreiche Städte in der Schweiz starten konkrete Projekte oder entwickeln Smart-City-Strategien. Das ist erfreulich und zeigt, dass unsere Städte die Chancen in diesem Ansatz erkannt haben», sagt Szemkus.
Städte können Kosten senken
Auch Vogt konstatiert der Schweiz ein grosses Potenzial bei Smart-City-Projekten, insbesondere bei der Senkung von Infrastrukturkosten, bei neuen Geschäftsmodellen und Services. Mit smarten Strassenbeleuchtungen, wie sie etwa die Stadt Wädenswil testet, könnten Kommunen laut Vogt bis zu 30 Prozent Energie sparen. Auch der Strassenverkehr könnte um etwa einen Drittel entlastet werden, gäbe es etwa neuartige intelligente Verkehrsleit- und Parksysteme. «Wir haben heute kein Infrastrukturproblem. Es ist die Frage, wie diese genutzt wird. Ein Auto wird nur zu 5 Prozent genutzt. Die restliche Zeit über wird es geparkt. Vogt kennt den Fall einer Gemeinde mit 10’000 Einwohnern, die vor Kurzem über 120’000 Franken für die Umstellung von Ticket- auf Nummernautomaten ausgegeben hat. Mit einer Bewirtschaftung der Parkplätze über ein Smart-Parking-System hätte diese Gemeinde mit der Hälfte der Ausgaben erst noch die Möglichkeit, über flexible Parking-Preise Mehreinnahmen zu generieren, zeigt sich Vogt überzeugt. Auch der öffentliche Personenverkehr (ÖV) kann profitieren. «Ich glaube, in ein paar Jahren werden Ticketautomaten weitestgehend verschwunden sein. Stattdessen werden wir an smarten Haltestellen Trams, Busse und Züge besteigen. Das Fahrzeug wird automatisch registrieren, wenn ich ein- und wieder aussteige. Wenn man sich überlegt, dass ein Kartenautomat bis zu 30'000 Franken kostet, lässt sich abschätzen, wie viele Kosten sich durch neue Technologien für die Abrechnung im ÖV einsparen liessen.»
Schweiz hat Nachholbedarf
Zahlreiche der neuen Geschäftsmodelle basieren darauf, viele Objekte besser zu nutzen. «Hier haben wir noch grossen Nachholbedarf in der Schweiz. Es besteht zudem die Gefahr, dass etwa Dritte aus dem Ausland sich einschalten und ein Geschäftsmodell auf der Schweizer Infrastruktur aufbauen. Doch auch hier zeigen sich erste Ansätze. Mit Green Class beschreiten die SBB neue Wege der Tür-zu-Tür-Mobilität, indem ein 1.-Klasse-GA kombiniert wird mit einem Angebot zur Nutzung eines BMW i3, eines Mobility-Carsharing-Autos oder eines PubliBike-Velos. Und mit den Apps Lezzgo, Fairtiq und Abilio können Fahrgäste verschiedener Verkehrsverbünde ohne Ticketautomat Fahrkarten lösen.» Die erstgenannten Apps zählten vergangenes Jahr zu den Masterkandidaten des Software-Wettbewerbs Best of Swiss Apps.
Braucht es den Smart-City-CIO?
In Fachkreisen wird zunehmend über die Rolle eines Smart-City-CIOs diskutiert. Szemkus sieht das nüchtern. Einen Smart-City-CIO brauche es nicht zwingend. Eine Stadt könne auch smarte Projekte realisieren, ohne dass jegliche ICT-Anwendungen zum Zug kommen. Schliesslich sei Technik immer nur Mittel zum Zweck und überdies nicht immer die richtige Wahl, sagt Szemkus. Grössere Städte würden aber nicht darum herumkommen, vermehrt ausgewiesene Spezialisten einzustellen. So wie dies jetzt auch geschehe. Wobei diese dann oft Chief Digital Officer hiessen. Für den Smart-City-Experten Vogt hängt die Frage vom Reifegrad einer Stadt ab. Langfristig werde es einen Smart-City-CIO brauchen. Vogt sieht ihn aber als Chief Data Officer. Denn nicht nur die Technik sei entscheidend, sondern künftig auch das Datenrecht. «Mit der Smart City muss ich auch neue Herausforderungen lösen. Es tauchen neue Fragen auf: Wem gehören die Daten? Wie gehe ich mit den Bürgerdaten um?»
Alle Beteiligten an einen Tisch bringen
Um die Weichen nachhaltig in Richtung Smart City respektive Smart Suisse zu stellen, gelte es, die Entscheidungsträger für das Konzept zu gewinnen und Pilotprojekte zu starten, sagt Szemkus. Smart-City-Experte Vogt rät Gemeinden und Städten bei Projekten, Entscheider aus den Bereichen Energie, Verwaltung und ÖV an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam eine Top-down-Strategie zu formulieren. Parallel dazu brauche es aber auch Bottom-up-Projekte. In jedem Amt sollten Mitarbeiter schauen, wo sie Probleme für die Bürger lösen können. «Ich vergleiche das mit einem vertikalen Tunnelbau. Von oben und von unten, und wenn sie sich in der Mitte treffen, dann gibt es einen sauberen Durchfluss.» Eine Herausforderung sei zudem, dass sich die Verwaltungen auf neue Herangehensweisen einlassen müssten, um themenübergreifend zu arbeiten und Dritte stärker einzubinden. Letztlich gehe es um Zusammenarbeit und Organisation. «Smart City ist keine technische Herausforderung. Es ist eine menschliche. Wenn jeder alles selber machen will in seiner Nische, kann keine Smart City entstehen.» Einen guten Weg gehe etwa die Stadt Winterthur. Anstatt eine separate Tourismus- und eine Standortförderung zu betreiben, bündelt die Stadt ihre Kräfte im House of Winterthur mit dem Ziel eines integrierten Standortmarketings. Dieses wird Anfang Dezember eröffnet.
Expertentipps für Smart-City-Projekte
- Bedürfnisse: Was sind die zentralen Herausforderungen respektive Probleme der Gemeinde/Stadt, die gemeinsam gelöst werden müssen? Welche Themenfelder lassen sich identifizieren. Welche Strategie lässt sich daraus ableiten?
- Teilhabe: Bürger einbinden, partizipieren lassen und auch Dritte, etwa Dienstleister, mit einbinden.
- Zusammenarbeit: Entscheider sollten die innerstädtische interdepartementale Zusammenarbeit fördern. Wichtig ist eine gute Projektleitung. Gemeinden sollten überregional kooperieren. Stichwort: Smart Suisse.
- Pilotprojekte: Konkretes realisieren und darauf aufbauen. Entscheider sollten sich nicht von der Themenvielfalt abhalten lassen.
- Austausch: Mit anderen Kollegen aus anderen engagierten Städten diskutieren, um voneinander zu lernen.