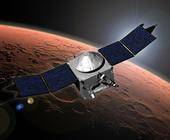10.11.2005, 19:36 Uhr
Metadaten
Vom Code-Kommentar zu SOA
«Reiche», durchorganisierte Metadaten liefern vor allem für die Arbeit im Team wertvolle Zusatzinformationen.
Metadaten sind Daten über andere Daten, soweit klar. Weniger eindeutig fällt dann schon die Antwort auf die Frage aus, ob sich Metadaten aus ihren «Basisdaten» ableiten, oder ob sie diesen quasi willkürlich zugeordnet werden.
Historisch gesehen gelten die formlosen Kommentare, die Programmierer zwischen die Codezeilen einfügen, als die ersten eigentlichen Metadaten. Einen Schritt weiter gingen die Java-Programmierer, deren Kommentare spezielle Formate befolgen. Sie lassen sich dann automatisch zu HTML-Dokumentationen umwandeln.
Die Kommentare sind informeller Natur, sie erläutern dem Menschen Design und Arbeitsweise einer Software. Nützlich sind sie insbesondere auch, um Konfigurations- und Geschäftslogik zu trennen. Weil solche Metadaten beim normalen Kompilieren verloren gehen, erlaubt die Dotnet-Architektur ebenso wie Java mit J2SE 1.5, sie in den generierten Code zu übernehmen. Beide Entwicklungsplattformen kennen zudem so genannte intrinsische Metadaten - Informationen über Objekte, Typen und Eigenschaften. Die Programme beschreiben sich quasi selbst und können daher mit anderen kooperieren. Die enge oder gar automatische Verzahnung von Daten und ihren Metadaten, die Entwickler anstreben, ist den Systemadministratoren oft ein Dorn im Auge. Dies, weil sie in manchen Fällen die Berechtigung brauchen, die Settings im Code durch andere Parameter überschreiben zu können.
Historisch gesehen gelten die formlosen Kommentare, die Programmierer zwischen die Codezeilen einfügen, als die ersten eigentlichen Metadaten. Einen Schritt weiter gingen die Java-Programmierer, deren Kommentare spezielle Formate befolgen. Sie lassen sich dann automatisch zu HTML-Dokumentationen umwandeln.
Die Kommentare sind informeller Natur, sie erläutern dem Menschen Design und Arbeitsweise einer Software. Nützlich sind sie insbesondere auch, um Konfigurations- und Geschäftslogik zu trennen. Weil solche Metadaten beim normalen Kompilieren verloren gehen, erlaubt die Dotnet-Architektur ebenso wie Java mit J2SE 1.5, sie in den generierten Code zu übernehmen. Beide Entwicklungsplattformen kennen zudem so genannte intrinsische Metadaten - Informationen über Objekte, Typen und Eigenschaften. Die Programme beschreiben sich quasi selbst und können daher mit anderen kooperieren. Die enge oder gar automatische Verzahnung von Daten und ihren Metadaten, die Entwickler anstreben, ist den Systemadministratoren oft ein Dorn im Auge. Dies, weil sie in manchen Fällen die Berechtigung brauchen, die Settings im Code durch andere Parameter überschreiben zu können.
Metadaten
Auch Endanwender treffen überall auf Metadaten. Jede Word-Datei steckt voll davon, zum Beispiel in Form von Autor, Datum, Schreibberechtigungen und so weiter. Wenn die Kategorien dieser Metadaten durchdacht gewählt werden, sind diese Informationen für Teamarbeiter extrem nützlich.
Auch im Internet debattiert man unter dem Schlagwort «Semantic Web» über Daten, die Querverweise zu anderen Daten liefern. Das World Wide Web Consortium (W3C) hat dazu RDF (Resource Description Framework) erfunden, sozusagen eine Grammatik für das Beschreiben und Austauschen von Metadaten. OWL (Web Ontology Language) ist das zugehörige Klassifizierungsmodell.
Kaum weniger ehrgeizig ist Microsofts kommendes Dateisystem Win-FS, obwohl es nicht das Web, sondern nur den eigenen PC organisieren will. Win-FS vermerkt neben gängigen Metadaten vor allem Verknüpfungen. Solche «reichen» Metadaten hatte schon das glücklose Betriebssystem Be-OS gekannt. Das Journaling-Dateisystem Reiser-FS - derzeit in der Version 4 vorliegend -, das viele Linux-Distributionen kennen, hat Be-OS darin beerbt.
Service-orientierte Architekturen (SOA) schliesslich führen vor, dass verschiedene Metadatensysteme untereinander kommunizieren können. Die Kunst dabei ist, den goldenen Mittelweg zu finden zwischen bewusst begrenzenden Kategorien und gleichzeitig eine Weiterentwicklung zuzulassen. Dazu braucht es kein einheitliches «Dachsystem»: XML ist die Lingua franca für das gegenseitige Verständnis von Daten und Metadaten.
Auch im Internet debattiert man unter dem Schlagwort «Semantic Web» über Daten, die Querverweise zu anderen Daten liefern. Das World Wide Web Consortium (W3C) hat dazu RDF (Resource Description Framework) erfunden, sozusagen eine Grammatik für das Beschreiben und Austauschen von Metadaten. OWL (Web Ontology Language) ist das zugehörige Klassifizierungsmodell.
Kaum weniger ehrgeizig ist Microsofts kommendes Dateisystem Win-FS, obwohl es nicht das Web, sondern nur den eigenen PC organisieren will. Win-FS vermerkt neben gängigen Metadaten vor allem Verknüpfungen. Solche «reichen» Metadaten hatte schon das glücklose Betriebssystem Be-OS gekannt. Das Journaling-Dateisystem Reiser-FS - derzeit in der Version 4 vorliegend -, das viele Linux-Distributionen kennen, hat Be-OS darin beerbt.
Service-orientierte Architekturen (SOA) schliesslich führen vor, dass verschiedene Metadatensysteme untereinander kommunizieren können. Die Kunst dabei ist, den goldenen Mittelweg zu finden zwischen bewusst begrenzenden Kategorien und gleichzeitig eine Weiterentwicklung zuzulassen. Dazu braucht es kein einheitliches «Dachsystem»: XML ist die Lingua franca für das gegenseitige Verständnis von Daten und Metadaten.