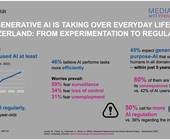«End-of-Life»-Situation
24.10.2007, 08:57 Uhr
Was ist jetzt zu tun?
Eine von uns eingesetzte Netzwerkkomponente wird früher als erwartet vom Hersteller durch eine neue Produktegeneration ersetzt. Dies zwingt uns zu einer flächendeckenden Migration. Können wir den Hersteller zur Rechenschaft ziehen?
Martin Bosshardt ist CEO von Open Systems, Zürich. www.open.ch
End-of-Life-Situationen von Hard- und Software sind keine ungewöhnliche Situation im Leben eines IT-Verantwortlichen. Ein schneller Produktezyklus wird durch Innovation und Produktequalität vom Markt erzwungen. Die Herausforderung, maximalen Nutzen bei geringstem Migrationsaufwand zu erreichen, wird dadurch aber erschwert, weil sich der Zeitpunkt einer Migration oftmals schwer planen lässt und entsprechend Budget und personellen Ressourcen für eine reibungslose Ablösung kurzfristig nicht bereit sind. Obwohl Hersteller bemüht sind, End-of-Life-Situationen frühzeitig anzukündigen und auch Geräte im End-of-Life-Status über einen längeren Zeitraum noch zu unterstützen, wird die verbleibende Zeit erfahrungsgemäss gerade im Infrastrukturumfeld mehr als benötigt.
Dass ein Hersteller für vorzeitige End-of-Life-Ankündigungen finanziell zur Rechenschaft gezogen werden kann, wird in aller Regel beim Kauf ausgeschlossen und liegt zudem langfristig nicht im Interesse des Kunden. Der Innovationsdruck verdrängt «langsame» Produkte und Anbieter automatisch. Die Herausforderung liegt darin, mit geringem Aufwand maximalen Innovationsnutzen zu erreichen. Der Aufwand für Evaluation, Testing und Dokumentation ist mit steigender Komplexität jedoch zuweilen enorm.
Ausgangspunkt bildet jeweils eine Liste möglicher Nachfolgeprodukte im Rahmen einer Grobselektion. Aus dieser Auswahl werden konkrete Nachfolgeprodukte identifiziert. Dabei muss sichergestellt werden, dass das neue Produkt reibungslos in die bestehende Infrastruktur eingefügt werden kann. Diese Tests sind insofern aufwändig, als verschiedene Konfigurationen in unterschiedlichen Situationen gefahren werden müssen. Mit erfolgreichem Abschluss der Kompatibilitätsprüfung kann grünes Licht für einen oder allenfalls zwei Nachfolge-Favoriten gegeben werden. Für den abschliessenden Nachfolgeentscheid muss geprüft werden, wieweit eine Migration automatisiert werden kann. Nur so könen der Aufwand für jede betroffene Instanz minimiert und Fehler weitgehend ausgeschlossen werden. Ein oft unterschätzter Schritt ist die Dokumentation des neuen Produktes. Dieser Aufwand ist wichtig für Governance und Auditierbarkeit und Voraussetzung, um neue Funktionen operativ auch nutzbar zu machen. Vor allem aber erlaubt eine klar aufgebaute Dokumentation den Wissenstransfer im Team und minimiert im Betrieb die Reaktionszeiten im Falle von Störungen.
Mit dem klassischen Ansatz der Systemintegration ist der operative Return einer solchen Migration für viele Unternehmen kaum zu schaffen.
Eine effiziente und finanziell attraktive Vorgehensweise ist die Bündelung einer grossen Zahl standardisierter Komponenten durch eine zentrale Betriebsgruppe. Das Geheimnis liegt in der grossen Zahl der standardisierten Installationen. Das Technology Cycle Management und die damit verbundenen Migrationen lassen sich praktisch linear durch die Anzahl betroffener standardisierter Geräte teilen. Grosse Konzerne profitieren von diesem Effekt und erhalten gegenüber kleineren Firmen einen Marktvorteil. Es sei denn, kleinere oder mittlere Unternehmen lagern den Betrieb solcher Infrastrukturkomponenten an einen Partner aus. Dabei gilt natürlich auch: je mehr identische Geräte der Partner betreibt, umso interessanter wird das Angebot für die Kundengemeinschaft. Der zentrale Kostenaufwand kann auf die zahlreichen Installationen umgelegt werden. So wird eine professionelle, operativ problemlose Migration günstig und es lässt sich eine überlegene Betriebsqualität bei minimalen Kosten erreichen. Firmen machen sich einen betrieblichen Skaleneffekt zu Nutzen, der weit über der eigenen Unternehmensgrösse liegt.
Martin Bosshardt