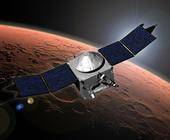17.08.2006, 11:13 Uhr
SBB will Airlines einholen
Bei den SBB wurden die Weichen für die künftige Informatik mit der Neuorganisation der zentralen IT sowie der Integration der Personenverkehr-IT und der Infrastruktur-IT gestellt. Computerworld sprach mit dem CIO, Andreas Dietrich.
Für den SBB-CIO Andreas Dietrich ist das Transitions-Projekt von T-Systems zu Swisscom IT-Services momentan die grösste Herausforderung.
Computerworld: Was wird sich mit der Neuorganisation ändern?
Andreas Dietrich:Die Verantwortlichkeit für die IT im gesamten Konzern ist wieder klar geregelt. Es stellt sich nicht mehr die Frage, was eine zentrale, eine divisionale oder gar eine IT in der Fläche macht. Die Situation ist heute so, dass wir in den drei Divisionen Infrastruktur, Personenverkehr und Cargo unterschiedlich grosse eigene IT-Organisationen betreiben. Aufgrund dessen ist es heute nicht klar, wer für welches Thema verantwortlich ist. Was wir jetzt gewählt haben, ist das Shared-Service-Modell, das auch in der Industrie state-of-the-art ist. Eine zentrale Supply-Einheit erbringt für alle Konzerneinheiten die IT-Dienstleistungen. Der Fachbereich konzentriert sich auf seine Aufgabe als Demander, der seine Businessanforderungen an die IT stellt.
Computerworld:Wieviele Mitarbeiter arbeiten in dieser zentralen Einheit?
Andreas Dietrich:Die Supply-Organisation ist eine virtuelle Einheit. Wir beschäftigen rund 400 eigene Mitarbeiter. Rechnen wir die Mitarbeiter der Dienstleister dazu, sind es etwa 1000 Leute.
Computerworld:Welche Vorteile ergeben sich aus dieser virtuellen Einheit?
Andreas Dietrich: Der Fachbereich muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, mit welchem Dienstleister er zusammenarbeiten soll oder muss. Die Business-Anforderung kommt bei uns herein und wir entscheiden über die beste Partnerkonstellation. In den meisten Projekten ist es ohnehin ein Konsortium.
Computerworld:Nach welchen Kriterien werden Dienste an externe Partner ausgelagert?
Andreas Dietrich:Wir haben eine klare Sourcing-Strategie, die wir seit Jahren verfolgen und jetzt noch konkretisieren. Bezogen auf die gesamte Wertschöpfungskette betreiben wir das ganze Blech, Rechenzentren und den Desktop nicht mehr selber. Selbst Server konfigurieren wir nicht mehr selber. Diese Dienste erledigen unsere Partner T-Systems und Swisscom IT-Services. Eine schlanke Organisation übernimmt das Provider-Management. In der Softwareentwicklung beschäftigen wir noch relativ viele Leute, weil wir einen sehr hohen Anteil an Eigenentwicklungen haben. Ebenfalls zu unseren Kernkompetenzen zählen wir das Portfolio-, Innovations- und Architektur-Management.
Computerworld:Wo besteht beim Outsourcing noch Nachholbedarf?
Andreas Dietrich:Bei der End-to-End-Verfügbarkeit. Es gibt noch relativ viel IT, die nicht in einem professionellen, geschützten, hochverfügbaren Rechenzentrum steht. Das ist durchaus nichts SBB-spezifisches. Es stehen irgendwelche Server unter dem Pult, auf denen zum Teil businesskritische Informationen lagern. Auch das «Managen von Risiken». Es herrscht heute noch wenig Transparenz.
Computerworld:Heisst das, dass Sie die Risiken nicht kennen?
Andreas Dietrich:Nach der Strompanne vom letzten Jahr hat die Geschäftsleitung konzernweit ein Risikomanagement aufgesetzt. Inzwischen sind wir in der IT so weit, dass wir eine gute Einschätzung haben, wo die Risiken liegen. Wir haben viel Zeit in die Basisarbeit investiert, um herauszufinden, wo was läuft und was für Wartungsverträge für diese Anwendungen bestehen. Nun sind wir dran, ausgehend von den Businessanforderungen, Anwendung für Anwendung und Plattform für Plattform nach Wichtigkeit zu klassifizieren, die Schutzstufen festzulegen und beides mit der tatsächlichen Betriebssituation abzugleichen.
Computerworld:Welches ist zur Zeit das grösste Risiko bei der SBB?
Andreas Dietrich: Die grösste Herausforderung ist das Transitions-Projekt von T-Systems zu Swisscom IT-Services. Davon ist die gesamte IT-Landschaft der SBB betroffen. Wenn wir da etwas falsch machen, steht alles still.
Computerworld:Wie wollen Sie diesem Risiko künftig begegnen?
Andreas Dietrich:Im Rahmen der Sourcing-Strategie bewegen wir uns bewusst in Richtung Multiprovider-Umgebung. Damit haben wir jederzeit die Möglichkeit, etwas zu verändern. Der jetzige Vertrag mit Swisscom und T-Systems läuft fünf Jahre. Danach gibt es die Option, diesen neu auszuschreiben oder ihn zu verlängern oder weiter aufzuteilen.
Computerworld: Wo sehen Sie ein weiteres Verbesserungspotenzial?
Andreas Dietrich:Noch haben wir so genannte Kompetenz-Center mit einer End-to-end-Verantwortung für Anwendungen oder Plattformen. Davon kommen wir ab und organisieren uns künftig Fabrik-mässig, das heisst analog eines Produktionsbetriebes. Wir haben dann einen Produktionsbereich mit der Hauptaufgabe Projektgeschäft, eine andere Fabrik ist für den Rechenzentrumsbetrieb verantwortlich und so weiter. Zug um Zug professionalisieren wir unsere IT in Richtung industrielle Produktion. Wir arbeiten konsequent nach ITIL, auditieren uns jährlich und schauen, was für einen Level wir erreicht haben und führen die entsprechenden Anpassungen durch. Dasselbe machen wir auch im Projekthaus, wo wir das Projekt CMMI gestartet haben.
Computerworld:Sie waren früher bei Kuoni, LTU und zuletzt bei Thomas Cook tätig. Kann die SBB von Ihren früheren Tätigkeiten profitieren?
Andreas Dietrich:Die Analogien sind erstaunlicherweise sehr gross. LTU ist eine Airline, Kuoni war damals ein reiner Operator und Retailer. Die Analogien von Thomas Cook zur Bahn sind frappant. Das Cargo-Geschäft ist praktisch identisch mit dem Airline-Cargo-Geschäft. Das Personenverkehrs-Geschäft hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Passage-Geschäft der Airlines. Überraschend für mich war, dass die Bahn ungefähr 5 bis 10 Jahre hinter den IT-Entwicklungen der Airlines herhinkt. Die Fluggesellschaften stehen in einem harten Konkurrenzkampf, was bei den Bahnen noch nicht der Fall ist. Speziell bei Cargo sehen wir, dass es rasant in diese Richtung geht. Wenn wir heute ein IT-Projekt vornehmen, dann orientieren wir uns nicht primär an anderen Cargo-Bahnunternehmen, sondern schielen zu den Top-Airlines.
Fredy Haag