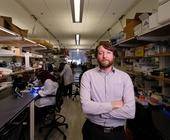Pressemitteilung
21.11.2025, 09:52 Uhr
Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität 2025
Kommentar von Martin Hager, Gründer und CEO Retarus, zum Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität 2025 – Von Debatte zu Delivery.
Der Gipfel in Berlin hat einen richtigen und längst überfälligen Schwerpunkt gesetzt: europäische digitale Souveränität. Die Ankündigung, von der Debatte zur konkreten Umsetzung zu kommen, ist wichtig. Entscheidend wird sein, ob wir den Mut finden, Abhängigkeiten tatsächlich zu reduzieren und eigene Lösungen in Europa zu bauen und zu skalieren.
Dabei stehen drei Punkte im Vordergrund:
1. Souveränität ist kein Schlagwort, sondern Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Betrieb. Jüngste Störungen grosser Cloud- und Plattformanbieter haben gezeigt, wie verwundbar Wertschöpfungsketten sind, wenn wenige Gatekeeper ins Wanken geraten. Wer kritische Prozesse verantwortet, braucht Wahlfreiheit, technische Transparenz und rechtliche Kontrolle – nicht nur Best Effort und wohlklingende SLAs.
2. Offene Standards sind die stille Infrastruktur der Unabhängigkeit. Europas Unternehmen haben mit offenen Protokollen wie GSM und ISDN gezeigt, wie Interoperabilität Kosten senkt und Resilienz erhöht und Innovation im Sinne des Kunden treibt. Proprietäre Abhängigkeiten von grossen Playern münden in Monopole und wirken gegenteilig. «Build versus Buy» ist daher eine differenzierte Architekturentscheidung für uns Europäer: Wo es kritisch ist, sollten wir bauen. Dort, wo wir kaufen, müssen Schnittstellen offen und portabel bleiben.
3. Regulierung muss befähigen, nicht lähmen. NIS2 und DORA adressieren reale Risiken, erhöhen aber massiv die Komplexität und Kosten, insbesondere für den Mittelstand und regulierte Branchen. Wenn wir Souveränität ernst meinen, braucht es vereinfachte, europaweit harmonisierte Regeln und Zertifizierung, klare B2B-spezifische Leitplanken und eine Umsetzung, die machbar ist. Sonst verlagern wir nur Lasten, ohne Resilienz zu gewinnen. Der angekündigte Digital-Omnibus muss genau das leisten: Regeln vereinfachen und harmonisieren – aber ohne Grundrechte zu schwächen und ohne Doppelregulierung.
2. Offene Standards sind die stille Infrastruktur der Unabhängigkeit. Europas Unternehmen haben mit offenen Protokollen wie GSM und ISDN gezeigt, wie Interoperabilität Kosten senkt und Resilienz erhöht und Innovation im Sinne des Kunden treibt. Proprietäre Abhängigkeiten von grossen Playern münden in Monopole und wirken gegenteilig. «Build versus Buy» ist daher eine differenzierte Architekturentscheidung für uns Europäer: Wo es kritisch ist, sollten wir bauen. Dort, wo wir kaufen, müssen Schnittstellen offen und portabel bleiben.
3. Regulierung muss befähigen, nicht lähmen. NIS2 und DORA adressieren reale Risiken, erhöhen aber massiv die Komplexität und Kosten, insbesondere für den Mittelstand und regulierte Branchen. Wenn wir Souveränität ernst meinen, braucht es vereinfachte, europaweit harmonisierte Regeln und Zertifizierung, klare B2B-spezifische Leitplanken und eine Umsetzung, die machbar ist. Sonst verlagern wir nur Lasten, ohne Resilienz zu gewinnen. Der angekündigte Digital-Omnibus muss genau das leisten: Regeln vereinfachen und harmonisieren – aber ohne Grundrechte zu schwächen und ohne Doppelregulierung.
Frankreichs Prioritäten – Finanzierung und eine europäische Präferenz bei strategischen Technologien – sind richtig. Sie erfordern allerdings parallele Investitionen in hiesige Fähigkeiten: KI-Kompetenz, Infrastruktur und ein Ökosystem, das Start-ups und Mittelständler über das reine Feiern hinaus konsequent beauftragt. Deutschlands Kultur der Risikoaversion ist hier eine echte Hürde. Wer Souveränität will, muss auch bereit sein, früher und öfter mit kleineren, innovativen Anbietern zu arbeiten – kontrolliert, aber entschieden. Öffentliche Beschaffung muss Kriterien wie EU-Datenstandort, Datensicherheit und Vermeidung von Vendor Lock-in deutlich höher gewichten und so europäischen Anbietern skalieren helfen. Ein Markt in dem Wachstum möglich ist, ist auch attraktiv für Wachstumskapital! Unternehmen wünschen sich heute Umsatz, keine Subventionen. Wir dürfen in diesen isolationistischen Zeiten keine Scheu haben, «buy European» auszusprechen.
Beim Thema Cloud müssen wir offene und flexible Architekturen etablieren. Diese machen Mehr-Quellen-Strategien sowie Verschlüsselungs- und Sicherheitsmechanismen nachvollziehbar und steuern die Datenhaltung gezielt nach Kritikalität, Compliance und Latenz. Dazu gehören klare Exit-Strategien, technische Beherrschbarkeit und eine belastbare Interoperabilität über Anbieter hinweg. Hier muss auf Modularität und einfache Standards geachtet werden, damit Unternehmen auch in der Lage sind, sich and die Nutzung dieser Architekturen heranzutasten – ganz im Gegenteil zu komplexen Architekturmodellen wie Gaia-X. Auf vollmundige Ankündigungen müssen bewusste Entscheidungen und technische Gestaltungsfreiheit folgen.
Wenn der Gipfel einen Impuls setzen soll, dann diesen: Wir definieren Souveränität als Wettbewerbsfähigkeit – messbar an Marktanteilen europäischer Lösungen, Time-to-Market und Exportquote. Wir vereinfachen und harmonisieren Regeln, um einen einfacheren Europäischen Marktzugang für unsere Anbieter zu ermöglichen und beschleunigen Genehmigungen für Rechenzentren und KI-Projekte, um Investitions- und Skalierungshürden zu senken, ohne Grundrechte zu verwässern. Zudem setzen wir verbindlich auf offene Standards und Interoperabilität, damit Anbieterwechsel, Multi-Sourcing und europäische Skalierung real werden.
Der Weg ist steinig. Doch er ist unumgänglich, um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Freiheit auch in Zukunft zu sichern.