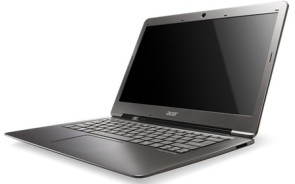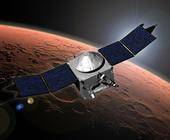Kommentar
16.09.2011, 08:20 Uhr
Intels Mär von der Ultrabook-Revolution
Chip-Hersteller Intel wird nicht müde, das Ultrabook als Revolution zu bezeichnen. Doch der Konzern macht dabei einen entscheidenden Fehler. Und: Warum die Zusammenarbeit mit Google nicht allein den Erfolg bringt.
Ultrabook ist ein von Intel eingetragenes Warenzeichen. Verwenden darf es nur, wer sich beim Herstellungsprozess an gewisse Richtlinien hält. Beispielsweise dürfen Ultraboks mit einer Displaydiagonale von 13,3 Zoll oder kleiner nicht dicker als 18 Millimeter sein. Darüber hinaus müssen diese eine Batterielaufzeit von einem Arbeitstag ermöglichen und nach dem Einschalten oder der Rückkehr aus dem Standby-Modus sofort betriebsbereit sein.
Damit Intels Vorstellungen korrekt umgesetzt werden, pumpt der Konzern 300 Millionen Dollar in die Industrie. Mit dem Geld werden aber nicht nur Hersteller unterstützt. Auch Händlern soll beigebracht werden, Ultrabooks richtig zu verkaufen. Beispielsweise dürfen in Interdiscount, Fust & Co. nur Ultrabook-Sektionen entstehen, wenn die Geräte tatsächlich Intels Vorgaben erfüllen. Das Ziel ist klar: Intel will auf biegen und brechen eine neue Gerätekategorie bilden, um die wegfallenden Umsätze aus dem Notebook-Markt zu kompensieren und den immer stärker wachsenden Tablet-Markt zu bremsen, in dem Intel kaum stattfindet.
Damit Intels Vorstellungen korrekt umgesetzt werden, pumpt der Konzern 300 Millionen Dollar in die Industrie. Mit dem Geld werden aber nicht nur Hersteller unterstützt. Auch Händlern soll beigebracht werden, Ultrabooks richtig zu verkaufen. Beispielsweise dürfen in Interdiscount, Fust & Co. nur Ultrabook-Sektionen entstehen, wenn die Geräte tatsächlich Intels Vorgaben erfüllen. Das Ziel ist klar: Intel will auf biegen und brechen eine neue Gerätekategorie bilden, um die wegfallenden Umsätze aus dem Notebook-Markt zu kompensieren und den immer stärker wachsenden Tablet-Markt zu bremsen, in dem Intel kaum stattfindet.
Neue Komponenten stehen schon bereit
Aber sind Ultrabooks tatsächlich eine neue Geräteklasse? Eine Revolution gar, wie Intel sie propagiert? Nein. Und zwar aus zwei Gründen: Erstens hat Apple mit dem MacBook Air schon vor 3,5 Jahren ein «Ultrabook» präsentiert und zweitens wurden leichte und leistungsstarke Laptops mit Windows bislang als Sub-Notebooks bezeichnet. Ein Ultrabook ist nichts anderes, abgesehen vom dünneren Formfaktor und der besseren Ausstattung. Deshalb dürfen Ultrabooks bestenfalls als Weiterentwicklung, aber keinesfalls als Revolution bezeichnet werden. Auf der nächsten Seite: Das bringt der Google-Deal
Doch die Entwicklung bei den Ultrabooks, von denen die ersten im November 2011 auf den Markt kommen, hat erst begonnen. Intel spricht am diesjährigen IDF über die nächsten Prozessorgenerationen IvyBridge und Haswell, die nächstes Jahr bzw. 2013 bereitstehen und mehr Rechen- sowie Grafikleistung bieten und stromsparender arbeiten. Welche Gründe gibt es also, sich bereits ein Ultrabook der ersten Generation zuzulegen? Eigentlich nur einen: Den tiefen Preis. Doch dieser wird bewusst unter 1000 Franken gehalten, um gegen das deutlich teurere MacBook Air von Apple zu konkurrenzieren.
Google als Heilsbringer?
Erfolg braucht Intel jedoch nicht nur bei den Ultrabooks, sondern muss endlich auch im Smartphone-Bereich Fuss fassen. Dort dominieren bislang die Konkurrenten ARM und Qualcomm, weil diese wesentlich stromsparendere Chips herstellen können. Den entscheidenden Schritt vorwärts will Intel mit der System-on-a-Chip-Plattform Medfield machen, dem Nachfolger von Moorestown. «Wir haben aus den Fehlern gelernt, die wir dort gemacht haben», sagte Intel-Vize Mooly Eden in einer Fragestunde am IDF. Ob Intel mit Medfield erfolgreicher ist, zeigt die Zukunft. Ein wichtiger Schritt ist in jedem Fall die Kooperation mit Google. Ein auf Intel-Hardware optimiertes Android kann für Hersteller wie HTC oder Samsung ein Argument sein, verstärkt darauf zu setzen. Allerdings muss Intel dafür seine seit Jahren bestehende Schwäche überwinden und endlich stromsparende Chips herstellen.