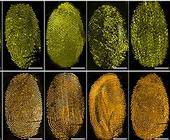29.08.2007, 08:52 Uhr
Träume weichen der Realität
Flexibilität und zeitliche Unabhängigkeit werden auch in der Ausbildung immer wichtiger. Mit aktuellen Techniken soll dies den Studenten durch E-Learning-Projekte ermöglicht werden. Solche Konzepte sind auch für die Wirtschaft interessant.
Die erste Euphorie ist verflogen. Wurde mit dem Aufkommen der IT und der weiten Verbreitung des Computers dem E-Learning die grosse Zukunft in der Bildung zugesprochen, ist heute Ernüchterung beim virtuellen Lehren eingetreten. Noch ist der Frontalunterricht nicht aus den Universitäten wegzudenken und dies wird auch noch lange so bleiben. Immerhin hat sich aus anfänglich vagen Ansätzen der -virtuellen Wissensvermittlung eine schweizweite Lernplattform entwickelt, die langsam aber sicher auch auf die Wirtschaft überschwappt. Wobei die Illusion, dass sich mit Web-basierten Techniken viel Geld sparen lässt, von der kostspieligen Realität abgelöst wurde.
Der virtuelle Lernplatz Schweiz
Bei den ersten Schritten mit E-Learning waren die Hochschulen noch auf sich allein gestellt. Ab und an stellte ein Dozent seine Unterlagen den Studierenden im Internet bereit und konnte sich so der vielen Studenten-Anfragen auf einfache Art und Weise entledigen. Bald merkte auch der Bund, dass Lehr- und Lernmethoden über das Internet Zukunft haben und rief 1999 den Swiss Virtual Campus (SVC) ins Leben. Das Programm zur Förderung von E-Learning-Projekten in der Schweiz hat bis heute 82 Onlineprojekte ermöglicht. Doch die 60 Millionen Franken, die dafür vom Bund bereitgestellt wurden, sind nahezu aufgebraucht und 2008 läuft das Programm aus. Weitere Zahlungen sind nicht geplant, obwohl die Aktualisierung und Pflege der Online-Lernressourcen stetig Geld verschlingt. Zwar fordert der Bund die Nachhaltigkeit der Projekte, sollen diese doch auf verschiedenen Plattformen einsetzbar sein und mit den jüngsten Techniken mithalten können. Doch das ständige Betreiben und Aktualisieren von Web-basierten Kursen kostet nun mal Zeit und Geld. Das soll künftig von den Hochschulen selbst aufgebracht werden.
Vom E- zum Blended Learning
Mit der Weiterentwicklung von computergestützten Lernmethoden sind auch in das E-Learning wesentliche neue Techniken eingeflossen. Heute wird kaum mehr von E-Learning gesprochen sondern von einem mehr integrativen Ansatz, dem Blended Learning (BL). Ziel des BL ist, dass der Studierende aktiv mit in die Projekte einbezogen wird. Er soll nicht nur als Konsument vor dem Bildschirm sitzen, sondern das Gelernte auch gleich anwenden und sein Wissen mit anderen austauschen - Web 2.0 lässt grüssen. An der Universität Zürich sind derzeit 17000 Studierende im Learning Mana-gement System (LMS) registriert. Ihnen stehen je nach Departement unterschiedliche Lernapplikationen zur Verfügung. Die Historiker verfügen etwa mit «Antiquitas» über eines der ersten BL-Projekte. Antiquitas ist ein interaktiver Workshop zur Geschichte des Mittelalters. Ziel solcher Angebote ist es nicht, den Präsenzunterricht zu ersetzen, sondern die Interaktivität der Lehre zu verstärken und das Bildungsangebot an der Universität zu erweitern. Trotz einiger Projekte konnte sich BL an den Hochschulen noch nicht überall durchsetzen. Zwar gibt es mit der Open-Source-Plattform «Online Learning and Training» (OLAT) bereits eine fachübergreifende Infrastruktur.
Diese fungiert derzeit jedoch mehr als PDF-Rangierbahnhof, obwohl es als BL-Baukasten dienen könnte. Mit der anstehenden Internationalisierung der Universitäten, vorangetrieben durch die Bologna Reform (siehe Box), wird auch die virtuelle Leistungskontrolle gefördert. An der Universität Zürich wird nach mehreren erfolgreichen Pilotprojekten diskutiert, in welcher Form Prüfungen standardisiert am Computer abgelegt werden können. Noch sind die unterschiedlichen Prüfungsformen der einzelnen Studienrichtungen ein Problem. Mit einem Entscheid der Universitätsleitung wird bereits in diesem Jahr gerechnet.
Von der Uni in die Wirtschaft
Ähnlich wie den Studienabgängern ergeht es den an den Unis entwickelten Applikationen: Sie werden von der Wirtschaft übernommen. Mit den Erfolgen Web-basierter Lehr- und Lernmethoden an den Hochschulen steigerte sich das Interesse der Industrie nach kostengünstiger Wissensvermittlung. Schnell mussten Anbieter aber realisieren, dass eine gute Online-Lern-Plattform nicht «schnell schnell» aus dem Boden gestampft werden kann. In der Schweiz haben sich in der Folge viele Unternehmen auf die Erstellung solcher Oberflächen konzentriert. Generell kristallisieren sich zwei Konzepte heraus: Auf der einen Seite stehen Anbieter, die Kundenwünsche durch Eigenentwicklungen realisieren und auf der anderen Seite stehen Projekte, die mit Open-Source-Applikationen erstellt wurden.
Open Source versus Lizenz
Zwei Schweizer Anbieter sind diese unterschiedlichen Wege gegangen: Die Walliseller «Ivaris» und die in Zürich, Fribourg und Bern ansässige «Liip». Letztere programmiert ihre E-Learning-Projekte auf Open-Source-Basis, während Ivaris eine Eigenkreation einsetzt. Grosse Unterschiede sind zwischen beiden Konzepten nicht auszumachen. Laut Ivaris-Gründer Jean-Pierre Kousz liegt der Vorteil seines Angebots in den speziell auf Kundenwünsche zugeschnit-tenen Lösungen. Die Kunden können durch eine breite Auswahl von Modulen, wie etwa Chat, Forum oder Dokumenten-Verwaltung, nur jene Programmteile implementieren lassen, die sie auch wirklich nutzen wollen. Dabei lässt sich die Plattform nach Belieben um ausgewählte Module erweitern oder reduzieren. Durch eine flexible Lizenzstruktur müssten Unternehmen oder Lehrinstitute nur für jeden lizenzierten Anwender bezahlen. Somit würde das Angebot auch für kleinere Unternehmen interessant. Viel anders sieht die Struktur von Liip nicht aus. Deren Geschäftsführer, Hannes Gassert, bietet mit verschiedenen Open-Source-Modulen ebenfalls jene Applikationen, die vom Kunden gewünscht werden. Einen Vorteil gegenüber Eigenkreationen sieht Gassert in der Interoperabilität der Software. Sollte ein Anwender einmal die Plattform wechseln, können die Open-Source-basierten Inhalte einfacher migriert werden.
Konzeptlos ins Verderben
Beide Experten sind sich über die grössten Fehler, die bei der Einführung von BL-Plattformen gemacht werden, einig: Zu oft werde angenommen, dass die Plattform als ganzes System geliefert werde und danach nur noch einen kleinen Unterhaltsaufwand benötige. Das sei ein grundlegender Fehler. Denn es ist elementar, dass Firmen ein Konzept erstellen, wie sie die Plattform in ihre bestehenden Strukturen einbinden und mit Inhalten füllen. Dabei ist die Umgebung dem Lehrprogramm anzupassen und wirkt in den meisten Fällen unterstützend, kann aber den Menschen nicht ersetzen. In diesem Punkt sollen allerdings die Vorteile des Zeit- und Orts-unabhängigen Webs genutzt werden. Daher arbeiten beide Anbieter mit einem didaktischen Partner zusammen, der die Kunden mit dem Erstellen von Konzepten und Inhalten berät.
Es irrt der Mensch solang er strebt
Ein weiterer Trugschluss ist, dass mit einer Lernplattform massiv Kosten eingespart werden können. Denn ihre Pflege und Aufrechterhaltung kostet viel Zeit und Geld. Lediglich bei der Verbreitung von Compliance-Schulungen bieten BL-Methoden eine flexible und kostengünstige Alternative zum Klassenunterricht. In der heutigen Zeit sind E-Lerning und BL-Umgebungen zwar nicht mehr wegzudenken, doch werden sie wohl nie den menschlichen Kontakt ersetzen können. In Universitäten wie in Unternehmen ist der Wissensaustausch von Mensch zu Mensch ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Kultur und in absehbarer Zeit nicht durch digitalisierte Kommunikation zu ersetzen.
Weitere Informationen
Swiss Virtual Campus (SVC): Das Bundesprogramm SVC will E-Learning-Projekte an Schweizer Universitäten fördern, welche sich auf innovative Informations- und Kommunikationstechnologien stützen. www.virtualcampus.ch
Bologna-Reform: Die Reform soll die Mobilität der Studierenden und die europäischen und internationalen Ausbildungsstätten nachhaltig verbessern. Die Schweiz hat sich mit 29 weiteren europäischen Ländern verpflichtet, die Ziele der Erklärung von Bologna bis 2010 umzusetzen.
www.parlament.ch/do-bologna
www.parlament.ch/do-bologna
Harald Schodl